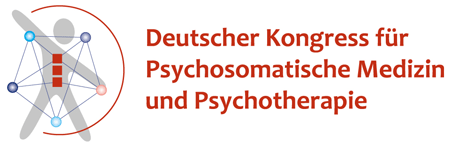Nachdem der organisatorische Aufwand bewältigt war, meine universitären Pflichtveranstaltungen zu
verschieben, um den letzten Kongresstag miterleben zu dürfen bin ich mit großer Vorfreude auf den
DGPM/DKPM Kongress 2023 am 04. Mai nach Berlin gereist. Da mein Hintergrund sowohl ein
Psychologiestudium beinhaltet als auch aktuell das Medizinstudium, war ich vor allem auf die
psychobiologischen Themen der Medizinischen Psychologie gespannt: Der Vortrag zum Einfluss von
Trauma auf die Stressreaktivität über Biomarker wie Cortisol hat mich sehr inspiriert. Sowohl Haar- als
auch Serum-Cortisolproben, Langzeit- und Reaktivitätsmarker wurden erhoben und in Beziehung zu
klinischen Veränderungen der Proband:innen gesetzt. Wir haben diskutiert, welcher Zeitraum als
„recovery“ gesehen werden sollte – die Forscher:innen hatten die klinischen drei Monate der PTBS
zugrundegelegt, wohingegen die neuroendokrinen Stressmarker oft eine längere Erholungszeit
benötigen. Ich fand es faszinierend, dass wir uns durch die klinischen Tätigkeiten oft verleiten lassen,
klinische Maße als Grundlage für neuroendokrinologische Marker zu nehmen, obwohl diese sich, z.B.
bzgl. der Latenz, unterscheiden. Mir hat es großen Spaß gemacht, mich mit anderen Forscher:innen aus
meinem eigenen Forschungsfeld darüber austauschen und auch den Gedanken der anderen
Zuhörenden lauschen zu dürfen.
Auch die Diskussion, ob es eine „krebsbezogene“ PTBS gäbe, fand ich unglaublich spannend. Als
angehende Ärztin habe ich mich schon öfter mit den psychischen Folgen von lebensbedrohlichen
somatischen Krankheiten, sowie dem Miterleben des Leidens und ggf. auch Sterbens anderer
Patient:innen für medizinische Laien beschäftigt. Die Diskussion hat mich in meiner Meinung bestätigt,
dass ein getrenntes Studium von Medizin und Psychologie unsinnig und allein historisch begründet zu
sein scheint. Ich wünschte mir, all meine Kommiliton:innen würden diesen Vortrag mit gehört und über
solche Themen nachgedacht haben!
Gleichfalls faszinierend fand ich die unterschiedlichen Herangehensweisen an (Trauma)Psychotherapie
mit Migrant:innen und den Umgang mit vorhandenen Sprachbarrieren. Kann ein:e Dolmetscher:in
durch das Übersetzen traumatischer Erfahrungsberichte (re)traumatisiert werden? Ist ein Dolmetscher
mit ähnlichem biographischen Werdegang zu vulnerabel um zu übersetzen oder kann nur er oder sie
das Vertrauen der Patient:innen gewinnen, sodass sie sich, trotz Anwesenheit einer dritten Partei,
öffnen? Wie viele Informationen gehen wohl verloren oder werden hinzugefügt? Ist es richtig, syrische
und ukrainische und türkische Migrant:innen getrennt zu untersuchen oder wäre ein gemeinsamer
„framework“ nicht vielleicht hilfreicher?
Antworten auf diese und viele weitere spannende Fragen habe ich zum Teil im Rahmen des Kongresses
finden können, aber es sind auch viele neue Fragen in mir aufgekommen, die zu beantworten vielleicht
Aufgabe des nächsten Kongresses ist. Meine Ohren werde ich auf Suche nach diesen und weiteren
Antworten offenhalten und meine Forschungsfühler um neue Richtungen und Denkansätze erweitern.
Ich danke dem Kongress-Team sehr für die Möglichkeit, Teil dieses Kongresses gewesen zu sein, und
freue mich bereits auf den nächsten